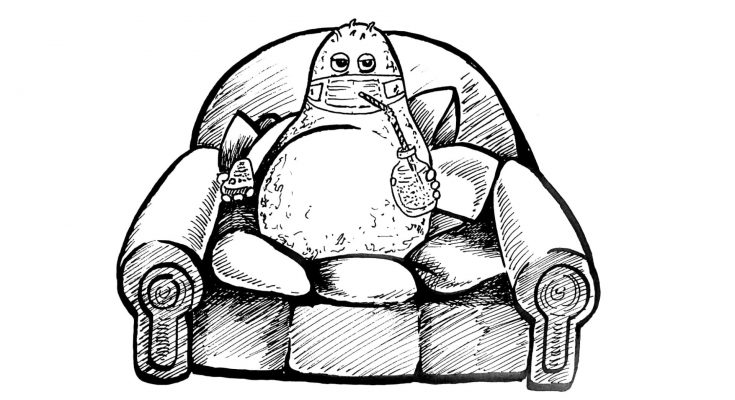von Doreen Ulrich, Claus Ludwig, Sebastian Rave, Oliver Giel und Seraphina Reisinger.
„Wildes Herz” – Volle Power gegen Nazis
ARD-Mediathek (bis zum 28.04.)
In seinem Porträt erzählt Charly Hübner die Geschichte von Monchi Fromm, Frontmann der Band „ Feine Sahne Fischfilet“. Dessen Lehrerin wundert sich im Film darüber, wie dieser Junge hat Sänger werden können. Monchi selbst singt von sich „Ich kann immer noch nicht singen, und spiele jetzt bei Rock am Ring“.
Die Doku zeigt den Werdegang Monchis vom Ultra mit Hang zur dritten Halbzeit zum Leadsänger und klaren Antifaschisten. Begleitet werden Fromm und seine Band auf ihrer „Noch nicht komplett im Arsch“-Tour während des Landtagswahlkampfes in Mecklenburg-Vorpommern 2016. In Kleinstädten werben sie dafür, gegen Nazis wählen zu gehen und supporten Aktionen gegen Faschist*innen, auch dort, wo diese im Alltag in unbequemer Mehrheit sind.
„Wildes Herz“ ist auch ein Heimatfilm. Regisseur Hübner (bekannt als Rostocker Polizeiruf-Kommissar Bukow) ist selbst Kind der Region. Er ertrug die „national befreiten Zonen“ in den 1990ern nicht mehr und ging nach Berlin. Feine Sahne entschieden anders: Sie blieben und setzen deutliche Statements. Gezeigt wird auch, wie der Verfassungsschutz die Band lange observiert, die mehr Zeilen in dessen Berichten füllte als alle Nazibands in MV zusammen. Dagegen wehrte sie sich.
Manch einer mag die Sprache, die Monchi benutzt, als zu grob und undifferenziert empfinden. Doch das Porträt zeigt einen authentischen Menschen. Einen, der auch dann gegen Nazis aufsteht, wenn er in der Minderheit ist und die Kameras schon weg sind. In diesem Sinne ist der Film auch ein Porträt über all jene, die in der Provinz den Arsch hoch und die Zähne auseinander kriegen und im alltäglichen Kampf Mut beweisen. Und dank diesen Menschen ist Mecklenburg-Vorpommern noch nicht komplett im Arsch.
Der Schacht
Netflix
Der Film des baskischen Regisseurs Galder Gaztelu-Urrutia erzählt eine einfache aber grausame Geschichte über die Klassengesellschaft. Ein Gefängnis über dutzende Etagen, in dem das Essen einmal pro Tag auf einer großen Plattform durch einen zentralen Schacht herabgelassen wird. Jede Zelle mit ihren zwei Häftlingen hat zwei Minuten Zeit, sich den Bauch mit den feinsten Köstlichkeiten vollzuschlagen – oder in den unteren Etagen das wenige zusammenzukratzen, was die Insassen über einem übrig gelassen haben. Einmal im Monat wird man mit Zellengenoss*in auf eine andere Etage verlegt.
Jede*r darf einen Gegenstand seiner Wahl in den Schacht mitnehmen: Eine Waffe, ein Seil, oder sogar einen Hund. Der Neuankömmling Goreng bringt als einziger ein Buch mit, und liest seinem mürrischen Mitgefangenen aus Don Quixote vor – die Geschichte des idealistischen Ritters im Kampf gegen Wahnsinn und Windmühlen. Das Buch steht für die Ideen, die das grausame System des Schachtes infrage stellen. Als Goreng seinem Zellengenossen vorschlägt, dass sich alle einfach nur so viel Essen nehmen könnten wie sie brauchen, fragt dieser barsch: “Bist du Kommunist?” – worauf Goreng antwortet, er sei “nur vernünftig”.
In der Brutalität der Ungleichheit, in denen einige nur durch Kannibalismus überleben, kann sich keine Solidarität einstellen, alle Appelle verhallen ungehört oder verlacht. Nur die Idee, Solidarität von oben zu erzwingen, funktioniert: Goreng droht den unteren Etagen, auf die Plattform zu scheißen, wenn sie sich mehr nehmen als sie brauchen. Aber: “Ich kann nicht nach oben kacken”. Gerechtigkeit scheitert an der Gier von “denen da oben”.
Aber auch diese sind Gefangene im Schacht und des Prinzips “jeder ist sich selbst der nächste”, das in Mangelsituationen überlebensnotwendig wird. Das Problem ist “die Verwaltung”, eine anonyme Macht, die das grausame Experiment durchführt, ohne die Verhältnisse zu kennen oder zu bewerten. Gerechtigkeit setzt Überfluss voraus. Im Schacht herrscht aber echter Mangel, wie sich herausstellt. Im echten Kapitalismus nicht: Es wird mehr Nahrung vernichtet – laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 1,3 Milliarden tonnen pro Jahr, davon könnte man zwei Milliarden Menschen ernähren – als für den Bedarf der hungernden Teile der Menschheit (821 Millionen Menschen) gebraucht würde.
Ohne das Ende des Films zu verraten: Das messianische “Zeichen” ist eines von vielen religiösen Anspielungen in dem beklemmenden Kammerspiel. Ob sie ein Ausdruck von Don Quixotischem Wahn ist, ohne den das Elend der Klassengesellschaft nicht zu ertragen wäre, oder ob einfach die Hoffnung in der Zukunft liegt: Im echten Kapitalismus außerhalb des Schachtes müssen wir uns jetzt organisieren und lernen, auch nach oben zu scheißen … “Zeichen” gibt es in großem Überfluss auf allen Etagen.
Miss Marples Erben
ZDF Mediathek
Vergesst Skandinavien. In der ZDF-Mediathek tummeln sich noch immer die Schweden-, Island- und Finnland-Krimis. Tolle Bilder, schöne Kamerafahrten, Stimmung pur. Aber die Handlung ist oft lau, unlogisch; Dialoge hölzern oder voller Klischees. Nicht alle sind übel, viele machen noch immer doppelt soviel Spaß wie ein Tatort. Aber heißer Scheiß geht anders. Der kommt inzwischen aus Großbritannien.
Nein, nicht Inspektor Barnaby und ähnliche Schnarchnasen. “Line of Duty” beschreibt die Arbeit einer Abteilung für interne polizeiliche Ermittlungen. Die Serie spart bei Lokalkolorit, Landschaften und spektakulärer Gewalt, aber nicht bei Dialogen, bei denen man zuhören kann und muss und differenziert gezeichneten Figuren. Statt Klischees wird eine komplexe und jederzeit spannende Handlung geboten.
“The Fall – Tod in Belfast” ist wieder im Programm. Neben der Sicht der ermittelnden Beamten, Gillian Anderson (Agent Scully aus “Akte X”) wird hier auch die ungewöhnliche Perspektive eines Serienmörders gezeigt. “The Bay” verzahnt unaufgeregt aber eindringlich einen Kriminalfall mit familiären Tragödien und dem Charakter von Protagonistin Detective Sergeant Lisa Armstrong (Morven Christie).
Die Känguru-Chroniken
u.a. Amazon Prime (16,99 Euro Kauf)
Am 5. März kamen „Die Känguru-Chroniken“ als cineastische Adaption der Känguru-Tetralogie von Marc-Uwe Kling in die deutschen Kinos. Der nach Klings Drehbuch von X Filme Creative Pool, ZDF, Trixter und ARRI Media Productions mit Dani Levy („Mein Führer“) in der Regie produzierte Film wird allerdings aufgrund der Covid19-Pandemie vor allem im Netz gesehen, wo er seit 2. 4. bei allen gängigen Anbietern verfügbar ist.
Die Protagonisten, das Känguru und ein Kleinkünstler nehmen den Kampf auf gegen den Jörg Dwigs, Immobilienunternehmer „Unsere Heimat AG“ und Vorsitzender der Partei „Alternative zur Demokratie“ (AzD), sowie dessen Frau Jeanette als dessen Mastermind. Mithilfe ihrer Kreuzberger Freund*innen, dem „Asozialen Netzwerk“, versuchen sie den Bau des Europatowers (eine Anspielung auf den Trump-Tower) zu verhindern, dem geplanten phallischen Zentrum von Gentrifizierung und europaweitem Rechtsruck mitten in Kreuzberg.
Känguru-Leser*innen wird auffallen, dass politische, historische und philosophische Gedanken und Anspielungen, die den Büchern eine gewisse Tiefe verleihen, völlig fehlen. Anstatt durch Anti-Terror-Anschläge, die als Propaganda der witzigen Tat auch die Passivität der Bevölkerung durchbrechen sollen, werden Probleme mit Nazis und Immobilienhaie schlussendlich durch die Polizei gelöst. Hier ist die Realität radikaler als der Film, hat doch die Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen” den realen Jörg Dwigs‘ den Kampf angesagt. Von Antikapitalismus fehlt aber im Film jede Spur, auch „Kommunismus“ wird nur ein einziges Mal am Rande erwähnt.
Kling hat die Schwierigkeit, eine Textsammlung in ein Drehbuch mit konsistenter Handlung umzusetzen, nur schlecht gemeistert. Das politische Anliegen des „Asozialen Netzwerkes“ wird zum Kreuzberger Szenekitsch, die Kritik an Kapitalismus wird zu einer medialen Enthüllung von Rechtsverstößen. Nur wirklich eingefleischte Freund*innen des Känguru-Universums werden an den über die 90 Minuten verstreuten Witzen und Szenen aus dem Buch ihre Freude haben, für „Nicht-Eingeweihte“ sind es schlicht Aneinanderreihungen von Absurditäten.
Der Überläufer
ARD Mediathek
Trotz der Verbrechen der Wehrmacht werden die Deserteure in Deutschland nicht wie Helden behandelt. Über sie ist wenig bekannt. Daher ist die Verfilmung des Roman-Fragments aus dem Nachlass von Siegfried Lenz ein interessantes Projekt. Die Umsetzung ist spannend und visuell gelungen. Das Spiel und die einprägsamen Gesichter von Jannis Niewöhner und Małgorzata Mikołajczak sind genug, um dem Vierteiler in den ersten beiden Teilen Schwung zu verleihen.
Akzeptabel ist auch, dass Walter Proska (Niewöhner) alles andere als ein ideologisch überzeugter Deserteur ist. Er ist hin- und hergerissen zwischen seiner Abscheu gegenüber dem Handeln der Wehrmacht, der Erkenntnis, dass der Krieg verloren ist und seiner “Treue” gegenüber Kameraden, Vorgesetzten und Staat. Er ist eine Mischung aus einem Träumer, der mehrfach sein Leben und seine Freiheit wegen einer Affäre mit einer polnischen Partisanin (Mikołajczak) riskiert, und einem bäuerlichen Pragmatiker, der überleben will. Er desertiert nicht, sondern wird von der Roten Armee gefangen genommen und von seinem ehemaligen Kameraden Wolfgang Kürschner (Sebastian Urzendowsky) aus der Gefangenschaft heraus für die Rote Armee rekrutiert.
Und da beginnt das (zu erwartende) Problem der Serie – die banale, oberflächliche pazifistische Haltung. Die Botschaft: “Der Krieg” ist schlimm, ebenso die Fanatiker aller Seiten. Walter Proskas Weg wird als eine Wechsel vom Regen in die Traufe geschildert. Er glaubt, die Rote Armee hätte deutsche Kriegsgefangene erschossen, die er zur Aufgabe überredet hat und die Zuschauer*innen sollen das auch glauben. Als er nach Kriegsende für die sowjetische Militäradministration in Berlin arbeitet und Vorgesetzte Druck machen, weniger Passierscheine auszustellen, weil sie vermuten, er siebe die Nazis nicht genug aus, da wird dies wie ein Akt der Unterdrückung dargestellt. Wolfgang hingegen wird zunehmend als Fanatiker geschildert, der eine neue Form von Unterdrückung rechtfertigt. Dabei ist er der eigentliche Held, der bewusst und in voller Kenntnis der Risiken entschieden hat, zu desertieren und für das Ende von Nazi-Deutschland zu kämpfen.
Die Übergriffe von Rotarmisten sind bekannt. Ebenso ist klar, dass in der sowjetischen Besatzungszone keine sozialistische Demokratie aufgebaut wurde, sondern eine bürokratische Herrschaft nach Stalins Vorbild. Doch das konnte Wolfgang nicht wissen. Seine Entscheidung, sein Engagement waren richtig. Das braucht ein Film nicht unkritisch zu schildern. Aber der historische Erkenntnisgewinn ist gleich Null, wenn lediglich hängen bleibt, dass “die Russen” auch nicht viel besser waren oder die polnische Heimatarmee skrupellos Züge in die Luft gesprengt hat.
Das Nazi-Regime musste gestoppt werden. Die Soldat*innen der Roten Armee, die Partisan*innen und die wenigen Desertierten haben dafür mit großen Opfern gekämpft und alles, was danach schief gelaufen ist, ändert nichts daran.
Bohemian Rhapsody
Amazon Prime (6,99 Euro Kauf)
Das Biopic über Queen-Sänger Freddie Mercury von 2018 (Oscar für die beste männliche Rolle 2019) hat Licht- und Schattenseiten. Die Darstellung durch Rami Malek (“Mr. Robot”) ist großartig, die Konzert-Szenen bis in die letzte Bewegung der Realität nachempfunden. Wie Queen sich ihre Musik erarbeiten, Innovationen entwickeln und durchsetzen ist plastisch beschrieben. Die Szenen im Proberaum und im Studio sind durchweg klasse. Die Geschichte von vier sehr unterschiedlichen, aber miteinander extrem kreativen Charakteren funktioniert und ist sympathisch. Fans der Band kommen durch die Zusammenstellung der Titel auf ihre Kosten.
Doch ausgerechnet Freddie Mercury als Hauptfigur bleibt seltsam blass. Das liegt nicht am Spiel von Rami Malek, sondern am Drehbuch. Die Entdeckung seiner Bisexualität wird verschämt jugendfrei beschrieben. Die Menschen um ihn herum werden in echte Freund*innen und irgendwelche Typen, die ihn nur ausnutzen wollen, sortiert. Letztere gehören überwiegend der schwulen Szene an. Im Film fallen keine homophoben Bemerkungen und das scheint auch nicht beabsichtigt, aber diese Trennung in die Guten und die Zwielichtigen könnte so interpretiert werden, dass die HIV-Infektion, an der Mercury 1991 viel zu früh starb, unvermeidlich war, weil er in dieses “Zwielicht” abtauchte.
Am Ende bleibt ein Gefühl, dass nicht Freddie der wirkliche Held ist, sondern Queen-Gitarrist Brian May. Freddie ist nett, genial. Aber nervig unsicher. Er wird mit Sympathie, aber oft auch mit eine Prise Mitleid betrachtet. Die Power des Ausnahmemusikers wird angedeutet, aber bleibt streckenweise unterbelichtet. Brian May hingegen ist immer korrekt, souverän und witzig, dazu ein treuer Freund und ebenso ein genialer Musiker. Gwilym Lee spielt ihn perfekt. Aussehen, Blicke, Bewegungen, wie eine Kopie der echten Filmaufnahmen von Queen. Es scheint, als hätte die Produktion nicht den Mut gehabt, die widersprüchliche Figur von Freddie Mercury zu einem echten Helden zu machen.
Kostenpflichtig abrufbar bei Prime sind inzwischen auch die von uns zuvor rezensierten Filme Parasite und Joker. Ohne Zuzahlung gibt es die von sozialismus.info vorgestellte Serie The Handmaids Tale.