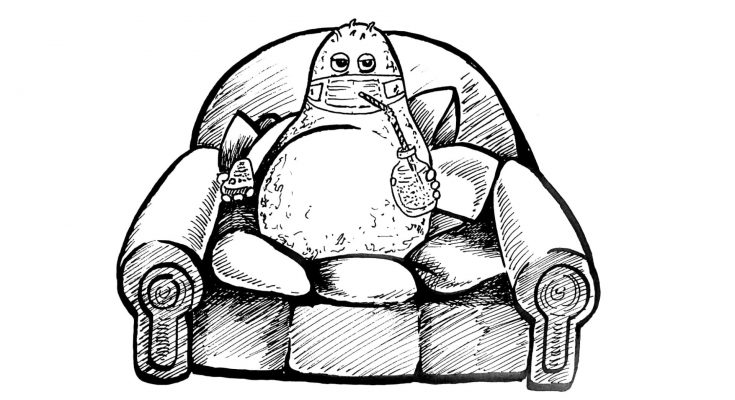I Am Not Your Negro
Arte-Mediathek & Netflix
James Baldwin ist eine der ganz großen Figuren der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung UND der LGBT-Bewegung. Der Schriftsteller verarbeitete seine Erfahrungen mit Armut, Rassismus und Homosexualität in machtvollen Essays. Der letzte davon, der unvollendete „Remember This House“, wurde dem linken Regisseur Raoul Peck („Der Junge Karl Marx“) zur Vorlage der Doku-Filmcollage „I Am Not Your Negro“.
Von Sebastian Rave, Bremen
Baldwin beschreibt seine Rolle als „Zeuge“ der Bürgerrechtsbewegung. Er verlässt sein Exil in Frankreich und kommt nach Charlotte, North Carolina, wo das erste Schwarze Mädchen auf eine öffentliche, „weiße“ Schule darf, und trotz heftigem Mobbing ihren Stolz bewahrt. Baldwin lernt Martin Luther King kennen, der Gewaltlosigkeit predigt, und Malcolm X, der die militante Gegenwehr „mit allen notwendigen Mitteln“ propagiert. „Zum Zeitpunkt ihrer Ermordung waren ihre Positionen praktisch zu ein und derselben Position verschmolzen“, stellt Baldwin fest.
Baldwin beschreibt eindrücklich die Entfremdung, die Schwarze Menschen in einer rassistischen Gesellschaft erleben, sobald sie im Kindesalter verstehen, dass sie nicht weiß sind. In einem der vielen Einspieler von Interviews und Reden Baldwins erzählt er, wie er als Kind Filme mit John Wayne sah und mitfieberte, wenn Native Americans erschossen wurden – bis er irgendwann verstand, dass er mit diesen Native Americans viel mehr gemeinsam hat als mit John Wayne.
Raoul Peck schafft es, mit aktuellen Bildern die Kontinuität die Unterdrückung der Schwarzen Amerikaner*innen zu unterstreichen. Bilder aus Ferguson und den ersten Black Lives Matter Protesten werden gegen die Bilder aus den 1960ern geschnitten. Das scheinbar nicht endende Leid macht wütend und betroffen. Aber wie Baldwin schrieb: „Ich bin optimistisch bezüglich der Zukunft, aber nicht der Zukunft dieser Zivilisation. Ich bin optimistisch bezüglich der Zivilisation, die diese ersetzen wird.“
Und der Zukunft zugewandt
In Amazon Prime enthalten
Der unaufgeregte Film über den Durchhaltewillen einer kommunistischen Aktivistin trotz eines Lebens voller Schrecken und Enttäuschungen ist nichts für einen lauschigen Filmabend, aber ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der DDR.
von Claus Ludwig, Köln
Die deutsche Kommunistin Antonia Berger (Alexandra Maria Lara) wird bei den stalinistischen Säuberungen Ende der 1930er Jahre in der Sowjetunion wie Zehntausende anderer Kommunist*innen zu Unrecht der „Spionage“ beschuldigt und im Zwangsarbeitslager Workuta inhaftiert. Ihr Mann wird erschossen, ihre im Lager geborene Tochter erkrankt schwer.
1952 sorgen Freund*innen im DDR-Apparat dafür, dass sie und einige andere Opfer der Säuberungen in die DDR ausreisen können. Antonia Berger will die Chance nutzen, sich am Aufbau der DDR zu beteiligen, einerseits, weil ihr nach Jahrens des Leidens Wohnung, Arbeit und Sicherheit für ihre Tochter geboten werden, andererseits, weil „nicht alles umsonst gewesen sein darf“. Die Genoss*innen versichern ihr, die dunklen Zeiten wären vorbei, solche „Fehler“ würden nicht wieder vorkommen. Für die offene Debatte sei man aber noch nicht bereit, sie müsse über die Lagerhaft schweigen.
Der Film von Regisseur Bernd Böhlich zeigt die bürokratischen Deformierungen der DDR, aber auch die anfänglich große Begeisterung der Menschen, eine neue, sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Alexandra Maria Lara spielt die gequälte Kommunistin intensiv, mit einem Gesicht, dass Bitternis und Hoffnung zugleich ausdrückt. Sie ist fast gebrochen, rappelt sich auf, gewinnt wieder Zuversicht, gerät erneut an ihre Grenzen – eine saubere schauspielerische Leistung.
Die Geschichte ist angelehnt an die Familiengeschichte der Schauspielerin Swetlana Schönfeld, die 1951 in einem sowjetischen Arbeitslager geboren wurde und in dem Film selbst die Mutter von Antonia Berger spielt.