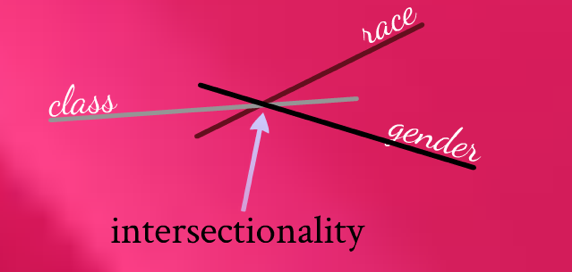Der Begriff „Intersektionalität“ ist in letzten Jahrzehnten ins Zentrum vieler politischer und sozialwissenschaftlicher Diskussionen gerückt – vor allem in den USA und Europa. Vereinfacht gesagt wird damit die Idee verbunden, dass sich verschiedene Unterdrückungen „überkreuzen“ bzw. überlagern, nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind und zusammenwirken.
Von Linda Fischer, Hamburg
Von Intersektionalität ist häufig in der akademischen Linken die Rede. Auch in sozialen Bewegungen, insbesondere der feministischen und antirassistischen, hat die Idee großen Einfluss. Auch in der Antidiskriminierungsarbeit, Sozial-, Kultur- und Bildungsarbeit wird sich mit der Frage beschäftigt, wie eine „intersektionale Perspektive“ eingenommen werden kann und muss. Die Omnipräsenz und Wirkmächtigkeit intersektionaler Ideen bedeutet, dass wir Marxist*innen uns damit auseinandersetzen müssen. Auch wir sehen, dass verschiedene Formen von Unterdrückung nicht unabhängig voneinander betrachtet und bekämpft werden können – kommen dabei allerdings bei zentralen Fragen zu anderen Schlüssen als intersektionale Analysen.
Kämpferische Anfänge
Erste intersektionale Ansätze entwickelten sich in den USA der 1970er aus Ideen Schwarzer Feminist*innen wie bell hooks und vor allem dem Combahee River Collective (CRC), einer Gruppe Schwarzer lesbischer Feminist*innen, die sich als Sozialist*innen verstanden und 1977 ein Selbstverständnis-Dokument veröffentlichten, das als erster intersektionalistischer Text gilt – auch wenn der Begriff „Intersektionalität“ erst 1989 von der eher liberalen US-Juristin Kimberlé Crenshaw geprägt wurde.
Das CRC bezeichnete die eigene Herangehensweise mit dem neuen Begriff „identity politics“, die „Identitäten“ Klasse, Geschlecht, Hautfarbe und Sexualität standen in der Analyse ineinander verschränkt, aber nicht ursächlich verbunden nebeneinander. Mitglieder des Kollektivs betonten später, dass sie keinen voneinander völlig isolierten Kampf der verschiedenen „Identitäten“ bzw. unterdrückten Gruppen anstrebten, sondern an den Aufbau von Koalitionen und gegenseitige Solidarität glaubten.
Im Statement heißt es: „Wir erkennen, dass die Befreiung aller unterdrückten Völker die Zerstörung der politisch-ökonomischen Systeme des Kapitalismus und Imperialismus sowie des Patriarchats erfordert. Wir sind Sozialistinnen, weil wir glauben, dass die Arbeit zum kollektiven Nutzen derjenigen organisiert werden muss, die die Arbeit verrichten […] und nicht für den Profit der Bosse. […] Wir sind jedoch nicht überzeugt, dass eine sozialistische Revolution, die nicht auch eine feministische und antirassistische Revolution ist, unsere Befreiung garantieren wird. Wir stehen vor der Notwendigkeit, ein Verständnis von Klassenverhältnissen zu entwickeln, das die spezifische Klassenposition Schwarzer Frauen berücksichtigt.“
Grundlage für die Verbreitung der Theorien von Intersektionalität und identity politics in den USA und international war zunächst eine gewisse Vernachlässigung mancher Formen von Unterdrückung durch die bestehenden Organisationen und Parteien mit marxistischem Anspruch, die antirassistische, feministische oder queere Bewegungen oft nicht ernst nahmen. Mit dem Zusammenbruch des stalinistischen Blocks und damit auch vieler kommunistischer und sozialistischer Organisationen im Westen, der damit verbundenen Schwächung der Arbeiter*innenbewegung und Zurückdrängung marxistischer Ideen konnte die Intersektionalitätstheorie zur wirkmächtigsten Theorie von Unterdrückung aufsteigen. Spätestens in den 1990ern geriet die vom CRC noch benannte Notwendigkeit, den Kapitalismus zu überwinden, weitgehend in Vergessenheit, und Identitätspolitik und Intersektionalität wurden zur theoretischen Legitimation (links-)liberalen politischen Handelns eingesetzt.
Später gab es in akademischen Debatten erneut eine Entwicklung kritischer Ansätze, die neben Identitäten auch gesellschaftliche Strukturen stärker berücksichtigen, aber auch sie analysieren die bestehende Gesellschaft meist nicht als Klassengesellschaft, sondern sehen „Klassismus“ als eine Form der Unterdrückung unter vielen.
Marxismus und Intersektionalität
Die US-amerikanische Dozentin und Aktivistin Ashley J. Bohrer versucht in ihrem Buch Marxism and Intersectionality eine Synthese von Intersektionsalitätstheorie und Marxismus. Sie benennt sechs Kernthesen von Intersektionalität: 1) Unterdrückungsformen sind untrennbar miteinander verwoben – ein Denken entlang einzelner Konfliktachsen wird abgelehnt. 2) Keine Unterdrückung ist wichtiger als die andere – Herrschaftsformen können nicht hierarchisiert werden; 3) Herrschaft ist auf mehreren Ebenen gleichermaßen und verwoben zu denken (individuell, strukturell, repräsentativ und diskursiv). 4) Identität sei als zentraler Bestandteil politischer Organisation und Theorie zu begreifen (was Bündnisse zwischen Gruppen als unabdingbare Voraussetzung einschließe); 5) Intersektionalität ist eine theoretische Orientierung, aber in aktivistischer Praxis entstanden. 6) Sie sieht sich als Kritik an Macht und Quelle von Gegenmacht.
Einige dieser Punkte sind mit einer marxistischen Analyse vereinbar. Auch Marxist*innen nehmen mehrere Formen der Unterdrückung in den Blick. Unsere Arbeit mit der sozialistisch-feministischen Initiative ROSA beinhaltet den Kampf gegen Sexismus, gegen die Unterdrückung als Arbeiter*innen im Kapitalismus und gegen Unterdrückungsverhältnisse, die manche Frauen und genderqueere Personen betreffen wie Homo- und Transfeindlichkeit sowie Rassismus. Die verschiedenen Formen von Unterdrückung und ihre Überschneidungen sind für verschiedene Personen im Leben unterschiedlich stark spürbar und spielen damit für das eigene Bewusstsein eine verschieden große Rolle – auch zwischen Menschen, die grundsätzlich von den gleichen Formen von Unterdrückung betroffen sind. Weil wir das anerkennen, könnte auch unsere Analyse dem Wortsinn nach als „intersektional“ bezeichnet werden.
Bohrer spricht jedoch von einer „Gleichheit der Unterdrückungsformen“ und wirft Marxist*innen vor, diese zu leugnen – insofern berechtigt, dass wir im Gegensatz zu intersektionalen Ansätzen diese Verhältnisse nicht als voneinander unabhängig entstanden sehen. Marxist*innen analysieren Sexismus und Rassismus als Produkte von Klassengesellschaften, in denen eine Minderheit über die Mehrheit der Menschen herrscht – das widerspricht natürlich der Idee, dass Sexismus, Rassismus und „Klassismus“ völlig gleich nebeneinander stehen.
Auch wenn der juristische und politische Überbau eine zum Teil wichtige Rolle für die gesellschaftliche Realität und ihre Entwicklung spielt und Formen von Unterdrückung sich in ihrer teils Jahrtausende langen Geschichte bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt haben, sind letztlich die Eigentums- und Produktionsverhältnisse und der Klassenkampf die entscheidenden Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung.
Um den Kapitalismus als heutige Ausprägung der Klassengesellschaft zu überwinden und die Grundlage für eine Gesellschaft ohne Unterdrückung zu schaffen, ist es notwendig, Bewegungen spezifisch unterdrückter Gruppen mit ihren eigenen Forderungen, Kampagnen und Anliegen miteinander zu verbinden, so dass sie Teil einer antikapitalistischen Bewegung der diversen Arbeiter*innenklasse werden.
Check your privilege!?
In intersektionalen und identitätspolitischen Ansätzen spielt das Privileg als „Abwesenheit von Diskriminierung“ eine große Rolle. Sie wollen Bewusstsein schaffen dafür, dass bestimmte Dinge, die zum Beispiel von Weißen oder „Biodeutschen“ als normal empfunden werden, für Menschen mit der „falschen“ Hautfarbe oder dem falschen Pass alles andere als normal sind und dass auf allen Ebenen, überall, tagtäglich Diskriminierung stattfindet. Das ist natürlich richtig. Aber der Fokus auf Privilegien ist in der politischen Praxis auf verschiedenen Ebenen problematisch:
Es wird unterstellt, dass die „Besitzer*innen“ von Privilegien auch Interesse daran haben, sie zu verteidigen. Damit wird letztlich das gemeinsame Interesse der Arbeiter*innenklasse, den Kapitalismus abzuschaffen, verneint. Der Aufruf zum gemeinsamen Kampf wird durch moralisch aufgeladene Forderungen ersetzt, die eigenen Privilegien zu reflektieren.
Das Denken in Privilegien blendet die gesellschaftlichen Strukturen hinter der Unterdrückung aus. Dazu gehören etwa staatlicher Rassismus oder die Profite, die aus der Unterdrückung der Frauen durch unbezahlte und schlecht bezahlte Arbeit im Kapitalismus gezogen werden.
Es führt nicht zu einem Verständnis der unterdrückerischen Natur des Kapitalismus. Unterschiede innerhalb der Arbeiter*innenklasse werden überbetont, statt die riesigen Privilegien der herrschenden Klasse anzugreifen.
Außerdem ist ein Leben ohne Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt kein „Privileg“ und nichts Negatives, sondern ein allgemeines Recht, das für alle Menschen durchgesetzt werden sollte.
Daher sprechen wir nicht von „Privilegien“, wenn wir gegen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit kämpfen, die es natürlich auch innerhalb der Arbeiter*innenklasse gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht bewusst damit umgehen, dass diese in der kapitalistischen Gesellschaft allgegenwärtigen Formen von Unterdrückung sich auch bei uns selbst auswirken können – aber das tun wir nicht, um uns wegen individueller „Privilegien“ zu „schämen”, sondern um Spaltungen innerhalb der Arbeiter*innenklasse aufzuheben und allen zu ermöglichen, sich mit uns gegen Kapitalismus und Unterdrückung zu organisieren.
Bild: Staynton, Wikimedia Commons, CC-BY-SA4.0