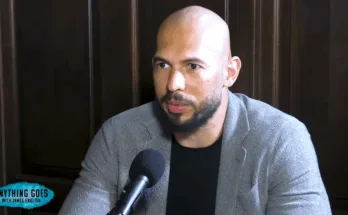„Ein halbwegs langweiliger Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit,“ schreibt Nadia Shehadeh. Aber sind nicht für viele Frauen und Kinder die eigenen vier Wände auch durch Gewalt geprägt? Und ist es nicht eine Errungenschaft, dass Frauen nicht mehr die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchen, um arbeiten gehen zu dürfen? Sicher – und auch dazu schreibt die Autorin eine Menge.
von Anne Engelhardt, SAV Kassel
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ihr Anti-Girlboss ist kein marxistisches Standardwerk. Was Nadia Shehadeh jedoch vor allem deutlich machen will ist, dass Arbeit im Kapitalismus, insbesondere für (migrantische) Frauen und Queers, immer Ausbeutung bedeutet, auch wenn man sie „gerne“ macht oder sie als „Erfüllung“ versteht.
Und darin ist das Buch einfach brillant. Wer Filme wie „Cruella“ oder „Der Teufel trägt Prada“ irgendwie gut fand, weil da eine junge Frau, die die Welt mit ihren Ideen verbessern will, einer Älteren den Rang abläuft, wird von diesem Buch vor den Kopf gestoßen: Girl-Bosse werden diese Welt nicht verbessern. Sie werden andere genauso unter sich ausbeuten lassen wie ihre älteren oder männlichen Klassengeschwister.
Shehadeh schreibt auch darüber, wer denn überhaupt zum Girl-Boss wird: junge Frauen aus reichen Elternhäusern, die sich und vor allem andere für Profite ausbeuten und das dann noch unter dem Banner „Feminismus“ verkaufen. Im Buch wird deutlich gemacht, dass die meisten als Frauen sozialisierte Menschen der Arbeiter*innenklasse eh schon von klein auf Arbeiten verrichten, die nicht anerkannt werden, aber ohne die das kapitalistische, patriarchale System zusammenbrechen würde und es keine Arbeitskräfte gäbe: jüngere Geschwister versorgen (Shehadeh selbst lernte mit neun Jahren zu wickeln), Putzen, Kochen, Waschen, Planen, Zuhören, Kinder kriegen, sich den Kopf aller anderen zerbrechen, Hausaufgaben betreuen, die Kita und Schulveranstaltungen organisieren, während die eigenen Wünsche und Bedürfnisse gar nicht mehr vorkommen.
Shehadeh hat Beziehungen durchgestanden, in denen sie als Vollzeit Arbeitende für ihre Partner mit eingekauft, mit geplant, mit geputzt, mit gekocht, mit gesorgt hat und von ihnen dafür noch abgewertet wurde. Sie ruft nicht dazu auf, keine Kinder zu bekommen oder keine romantischen, heterosexuellen Zweierbeziehungen zu führen, was sie für sich selbst entschieden hat, weil ihr Mutter-Akku“ einfach irgendwann leer war. Aber sie beschreibt eine alltägliche Schieflage, in der jungen Frauen eingetrichtert wird: wenn sie sich ausruhen, wenn sie Zeit für sich beanspruchen, wenn sie einen Job nicht machen wollen, wenn sie „Nein“, sagen, dann würden sie nicht anerkannt, nicht geliebt, nicht wertschätzt und es schon gar nicht zu Ehe, Karriere, Kindern bringen.
Bei weiblichen migrantischen Kolleg*innen wird eher der Vorwurf erhoben, sie seien faul, weil sie den Geschirrspüler in der Teeküche nicht ausgeräumt haben. Bei männlichen biodeutschen Kollegen wird gejubelt, wenn sie drei Monate Elternzeit nehmen. Das Buch handelt von persönlichen Erfahrungen, nicht von Streiks oder Revolutionen. Aber es macht sehr kluge Beobachtungen, wie wir als Frauen Sozialisierte uns – ob mit revolutionärem Anspruch oder nicht – immer auch ein bisschen zu viel abverlangen und zu viel von uns verlangt wird. Natürlich kann nur ein Kampf gegen dieses Klassensystem alle Bosse – egal ob Girl, Boy, Inter, Trans, oder sonst wie gelabelt – abschaffen. Aber auch im alltäglichen Konflikt mit dem System kann man sich und andere manchmal vielleicht mehr schätzen, dafür, dass sie lieber ein Mittagsschläfchen auf der Couch machen, als einmal zu viel für das System gearbeitet zu haben.
Nadia Shehadeh, Anti-Girlboss – Den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, Ullstein, 224 Seiten